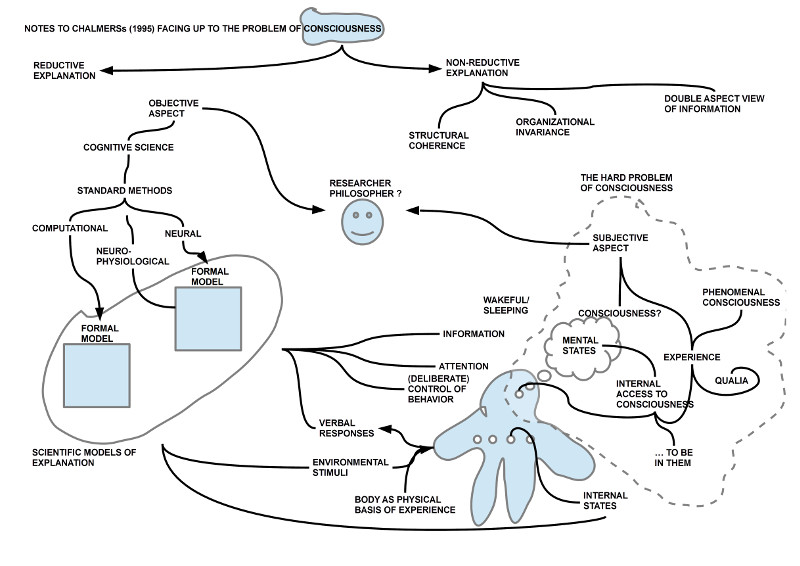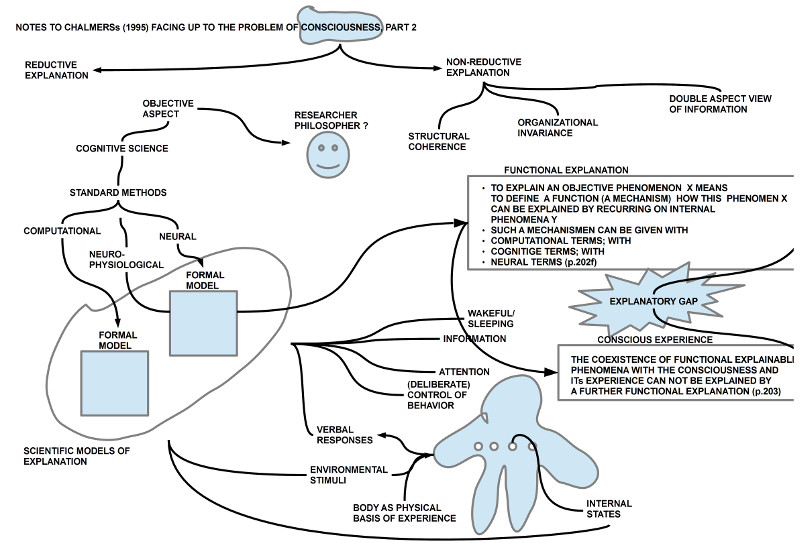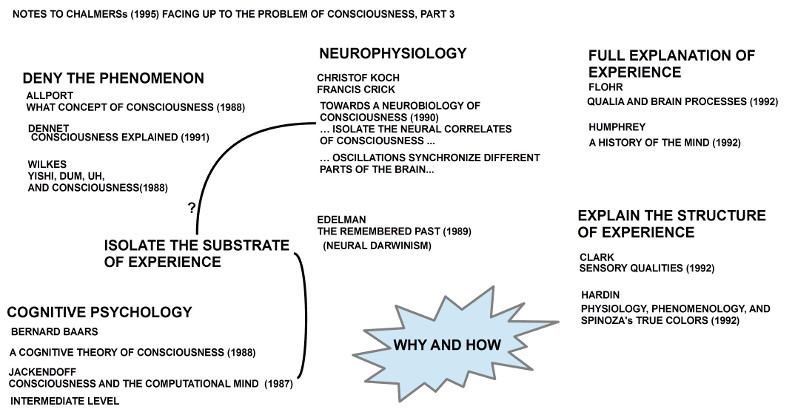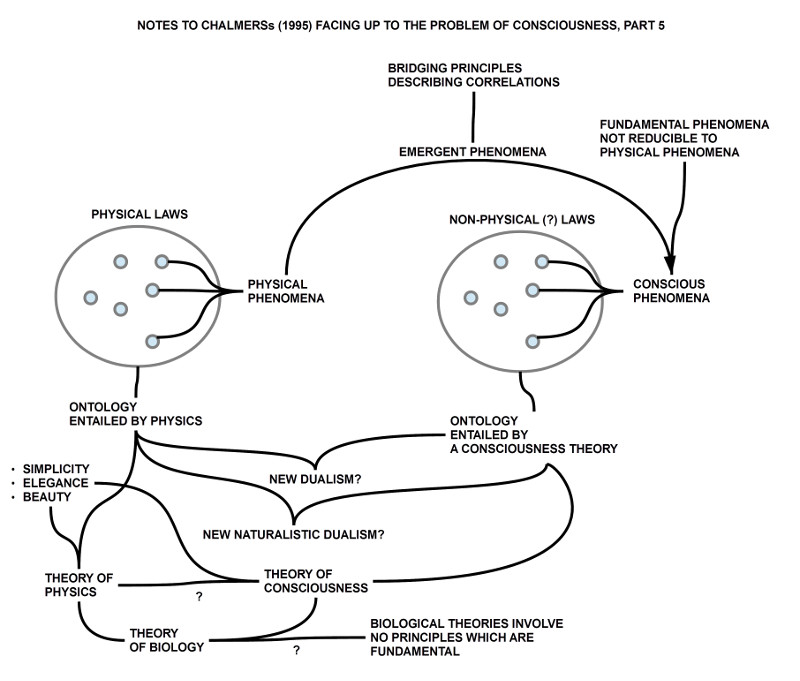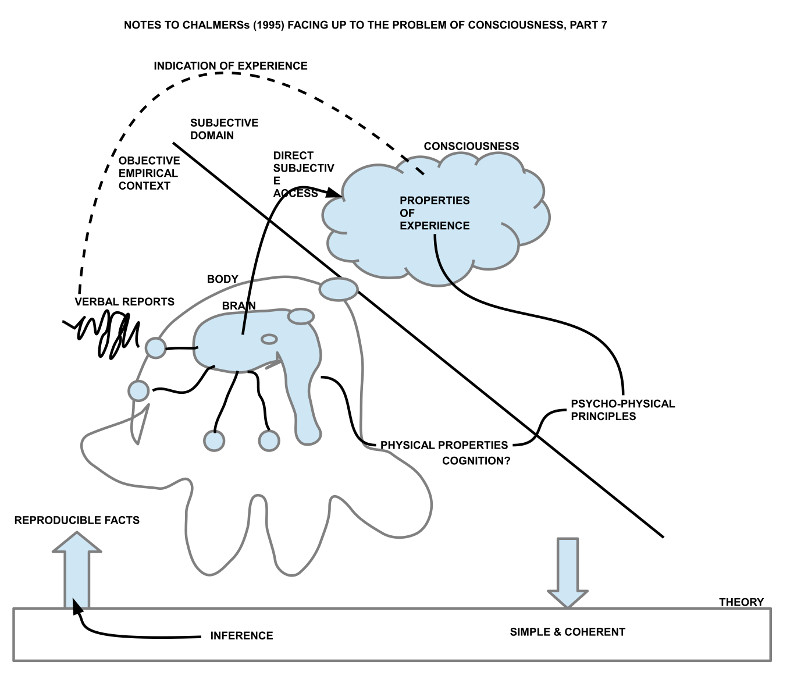Journal: Philosophie Jetzt – Menschenbild, ISSN 2365-5062, 17.Sept. 2019
URL: cognitiveagent.org
Email: info@cognitiveagent.org
Autor: Gerd Doeben-Henisch
Email: gerd@doeben-henisch.de
KONTEXT
Das Reden von der ‚Zukunft‘ klingt oft so isoliert, so abgetrennt, so fern, so unerreichbar, und doch begleitet uns die potentielle Zukunft — unsere potentielle Zukunft — auf Schritt und Tritt in unserem Handeln.
Es sind unsere eigenen Entscheidungen, was wir tun wollen, die immer wieder einen kleinen Schritt in eine bestimmte Richtung nach nicht ziehen, die unsere Zukunft eröffnen.
Natürlich sind diese individuellen Entscheidungen nicht isoliert vom Kontext, vom gesamten Lebenszusammenhang, aber doch, ja, wir kopieren nicht irgendetwas, wir mit unserer konkreten Persönlichkeit erzeugen ein kleines Stück Wirklichkeit, das eine Teil des je größeren Zukunftsszenariums darstellt.
Diese unseren individuellen konkreten Handlungen können zufällig sein, intuitiv, mögen planlos erscheinen, aber in der Regel stehen dahinter konkrete Motivationen, bestimmte Bilder, die wir aktuell von der Welt haben, und das Ganze meistens mit anderen vernetzt durch Kommunikation.
Im allgemeineren Fall, dort, wo es etwas professioneller wird, begegnet uns die Zukunft im Rahmen von Problemlösungen. Einer bestimmten Gruppe von Menschen stellt sich ein ‚Problem‘ verbunden mit einer minimalen ‚Vision‘ wie es denn stattdessen sein sollte, und dann versucht man diese Vision möglich zu machen, ein Stück Arbeit für die Zukunft und dann deren Realisierung.
Probleme müssen in vielen Bereichen gelöst werden und entsprechend haben sich in vielen Bereichen unterschiedliche Vorgehensweisen etabliert, wie man das macht: in den empirischen Wissenschaften, bei den Ingenieuren, bei Ärzten, Architekten, Kriminalpolizei, im Case Management, und vielem mehr.
Im folgenden Text soll von diesen speziellen Verfahren abstrahiert werden und der Frage nachgegangen werden, wie eine Problemlösung im Alltag funktionieren kann bei der beliebige Menschen beteiligt sind, vorzugsweise Gruppen von Bürgern, Kommunalverwaltungen, ganze Kommunen (Gemeinden, Städte).
ALLTAGSPROBLEME AUS DEN MEDIEN
Wenn man sich heutzutage in den Medien umschaut, mit Freunden und Bekannten spricht, dann kann man den Eindruck gewinnen, wir sind von Problemen umzingelt. Hier ein kleine Stichprobe aus drei Zeitungen von wenigen Tagen:
- Ortsbeiräte und Stadtverordnete sollen durch eine bürgernahe Stadtwerkstatt ergänzt werden, um die Anliegen der Bürger besser einbinden zu können
- Das Problem des bezahlbaren Wohnraumes wird in den Städten immer schlimmer. Jährlich fallen deutlich mehr Wohnungen aus der Sozialbindung als neue geschaffen werden
- Eine Großstadt verweigert sich offiziell, Sozialwohnungen ohne Befristung zu bauen.
- Forscher konstatieren zum Teil dramatischen Rückgang bei bestimmten Vogelarten. Dies verweist auf einen Mangel an geeignete Lebensräume.
- Die Waldbesitzer in ganz Deutschland melden riesige Schäden durch Trockenheit.
- Die Bedrohung von BürgermeisterInnen durch radikale Gruppierungen nimmt beständig zu; einige geben auf
- Ortsbeiräte sollen das besondere Ohr zum Bürger darstellen. Aber, welcher Bürger kennt seinen Ortsbeirat? Und in der Stadtverordnetenversammlung, wer hört die Ortsbeiräte?
- Immer wieder Auffälligkeiten, dass der Verfassungsschutz Bezüge zu rechten Gefährdern unterbewertet
- Ein Kultusministerium will ein Schulamt weg verlegen aus seinem Bezirk und bürdet damit seinen Mitarbeitern zusätzliche Belastungen auf.
- Das ganze politische System Deutschlands benötigt ein Update, um zukunftsfähig zu werden
- Die großen Internetkonzerne merken, dass ihre Wirkung auf die Gesellschaft langsam Rückwirkungen erzeugen, die in immer größeres Misstrauen, wenn nicht gar partiell Feindschaft umschlagen. Plötzlich sprechen sie davon, dass Vertrauen das Wichtigste sei, sowohl in der Firma wie auch zur umgebenden Gesellschaft.
- Saubere Motoren alleine reichen nicht für eine weltweite Verbesserung des Verkehrs in den Metropolen
- International ist viel Geld da, das nach Anlage drängt, gleichzeitig gibt es aber zu wenige gute Anlageobjekte. Das Anlegen geschieht dennoch, vorbei an regulierten Finanzmärkten; Wertsteigerungen auf dem Papier werden verbucht, denen immer weniger realer Gegenwert entspricht (dies erzeugt eine massive Inflation, die von den Zentralbanken nicht erfasst wird)
- Der Chef eines der größten internationalen Ölkonzerns verkündet den nachhaltigen Umbau des Konzerns in Richtung Unterstützung erneuerbaren Energien, investiert aber bis auf Weiteres immer noch den größten Teil des Geldes in das Ölgeschäft
- Während der größten internationalen (Auto)-Mobil(itäts)-Ausstellung stehen sich tausende von Demonstranten und zehntausende Besucher ideell gegenüber.
- Keiner der weltweit größten Erdöl- und Erdgas-Konzerne ist auf Klimakurs
- Während die Reduzierung den Einsatz von EMobilität pushed, zeigen Fachleute vielfältige Probleme auf, die damit noch nicht gelöst sind oder gar durch EMobilität erst neu erzeugt werden.
- Bahn und Nahverkehr sollen ausgebaut werden, beim Bahnhofsumbau z.B. in Frankfurt sind viele Fragen noch offen; es wird Jahre dauern…
- Eine Buchbesprechung thematisiert die neue Sichtweise der Neurowissenschaften und die Wirkung auf andere bisherige Sichtweisen auf den Menschen. Vereinfacht gesagt: Die Reduktion des Menschenbildes auf Gehirnfunktionen.
- Der Konflikt zwischen einem Whistleblower (Snowden), der von seinem eigenen Staat nicht als solcher anerkannt wird, und der für die Interessen einer offenen, demokratischen Gesellschaft gegen ihre scheinbar übermächtig gewordenen geheimen Institutionen eintritt.
- Eine Diskussion um das rechte Verhältnis von Import/ Export, Realzinsen, und Fiskalpolitik im globalen Miteinander. Missverhältnisse können zu Verzerrungen, Abschottungen und mehr führen.
- Die intransparente Rolle von politischen Beratern jenseits der demokratischen Verfahren.
- Weltweit steigen die Schäden für Rückversicherer.
- Weltkonzerne stehen vor der Aufgabe, sich global neu zu orientieren ohne aber verlässliche politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu haben.
- Der starke Verfall von demokratischen Rechten und Gepflogenheiten in Hongkong am Beispiel der Fluggesellschaft
- Mikroplastik ist überall (Weltmeere, Flüsse, auch durch die Luft) auf dem Vormarsch
- Das Ringen um eine europäische Cloud als Alternative für mehr Unabhängigkeit im Datenverkehr.
- Der Zuwachs an Rechenkapazität in der Forschung wird durch technische Barrieren verlangsamt. Die Forschung wird durch Vorlieben der Bundesregierung nur einseitig gefördert.
Schon diese kleine Auswahl lässt ganz unterschiedliche Kontexte aufblitzen, die jeweils vorausgesetzt werden:
- Es geht um Menschen, verschiedene Tierarten und den Wald, deren Lebensräumen sich wechselseitig beeinflussen.
- Es geht um die Umwelt, die durch die Aktivitäten des Menschen unterschiedlich verändert wird.
- Es geht um Kommunen/ Städte, die den direkten Lebensraum für die Menschen (und viele Tiere) darstellen.
- Es geht um staatliche Institutionen, die bestimmte Aufgaben erfüllen sollen.
- Es geht um Bürgerrechte und die Demokratische Öffentlichkeit.
- Es geht um globale Konzerne, die sich mit unterschiedlichen nationalen Forderungen arrangieren müssen.
- Es geht um Technologien, um technologischen Abhängigkeiten und deren Bedeutung für die Wirtschaft und die staatliche Autonomie.
- Es geht um Weltbilder, die von unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen gespeist werden.
- Es geht bei allem auch immer um einzelne (Bürger, Bürgermeister, Stadtverordnete, Ortsbeiräte, Präsidenten, Firmenchefs, …), die sich in den jeweiligen Kontexten ‚verwirklichen‘ wollen.
- Einzelne lassen sich von dem jeweiligen Weltbild in ihrem Kopf leiten oder holen sich spezielle Berater, die ihr Weltbild unterstützen sollen.
WANN IST ETWAS EIN PROBLEM?
Dies aufgelisteten Fälle vorausgesetzt kann man die Frage aufwerfen, ob man bei den eingangs erwähnten Beispielen tatsächlich von ‚Problemen‘ sprechen sollte. Warum soll eine bestimmte geschilderte Sachlage als ein ‚Problem‘ bezeichnet werden? Warum sollte man in der mangelnden Einbindung von Bürgern in den Kommunen ein Problem sehen? Warum ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ein Problem? usw.
WELTBILD UND ZIELVORSTELLUNGEN
Offensichtlich setzt das Sprachspiel ‚Problem‘ voraus, dass die Beteiligten als Teil ihres jeweiligen Weltbildes bestimmte ‚Zielvorstellungen‚ haben, die für sie als ‚erstrebenswert‘ gelten, und im Lichte dieser Zielvorstellungen kann dann eine bestimmte Sachlage als ‚Problem‘ klassifiziert werden. So z.B.: Wenn man die Einbindung der Bürger innerhalb einer Kommune als erstrebenswert ansieht (Begründung?), dann kann man eine mangelnde Einbindung als ‚Problem‘ klassifizieren; wenn hinreichend verfügbarer bezahlbarer Wohnraum als erstrebenswert angesehen wird (Begründung?), dann kann man den Mangel als Problem klassifizieren. Und analog in all den anderen Fällen.
Was sich schon in diesen wenigen Beispielen andeutet, ist die Notwendigkeit, dass man zur Diagnose von Problemen über ‚erstrebenswerte Zielvorstellungen‘ verfügt, die auch von den anderen Beteiligten geteilt werden.
Wie diese ersten Beispiele aber auch zeigen, kann man nicht unterstellen, dass alle Beteiligten tatsächlich über eine Zielvorstellungen verfügen und falls doch, dass diese bei allen Beteiligten gleich sind.
So ist das Wort Bürgerbeteiligung in vieler Munde, man kann aber wenig konkrete Maßnahmen erkennen, die dies real unterstützen. Fachabteilungen in Kommunen sind einer Bürgerbeteiligung gegenüber tendenziell eher ablehnend, weil es die Arbeit ‚verkompliziert‘. Über hinreichend viel bezahlbaren Wohnraum wird seit Jahren diskutiert, seit Jahren aber tut sich nichts. Die Zerstörung von Lebensräumen von bestimmten Tierarten wird von Naturschützern angeklagt, aber viele handelnde Gruppierungen interessiert dies nicht. Fehlleistungen des Verfassungsschutzes (im Bund und auf Landesebene) werden immer wieder diagnostiziert, aber diese öffentliche Kritik zeigt bislang keine erkennbare Wirkung. Die einen ziehen aus den bisherigen Erkenntnissen zur Klimaänderung bestimmte Schlüsse (z.B. für den ganzen Bereich Verkehr, Mobilität), andere sehen dies als überzogen und unrealistisch an. Und so weiter.
Schon beim Aufsammeln von Problembeschreibungen stößt man also auf eine nicht einfache Problematik: die Ausgangslage für die Problemfeststellung liegt in den jeweiligen Weltbildern der Beteiligten, und dort insbesondere im Bereich der ‚erstrebenswerten Zielvorstellungen‘. Setzt man diese ‚erstrebenswerten Zielvorstellungen‘ ‚absolut‘, dann gibt es harte, unversöhnliche Fronten.
Andererseits, Weltbilder und erstrebenswerte Zielvorstellen sind nicht angeboren sondern resultieren aus Interaktionen des einzelnen mit seiner Lebenswelt. Im allgemeinsten Sinne kann man dies ‚Lernen‚ nennen: die Aneignung von Vorstellungen über die Welt, mit Hilfe deren man sich die Welt ‚erklärt‚ und mit deren Hilfe man sein Verhalten ‚orientiert‚.
Grundsätzlich kann man also immer versuchen, die eigene gelernte Sicht der Welt auf den Tisch zu legen und dabei deutlich machen, warum man bestimmte Ansichten für erstrebenswert hält.
FAKTOR MOTIVATION
Der Faktor Weltbild inklusive möglicher Zielvorstellungen ist im Alltag allerdings nur ein Faktor. Zusätzlich wirksam sind noch viele psychische Faktoren, die hier aus Sicht des Verhaltens zusammenfassend angenommen werden als ‚Motivation‚, also jene internen subjektiven Faktoren, die einen Menschen dazu bringen, sich eher einer Sache ‚zuzuwenden‘, sie ‚aktiv zu betreiben‘, oder, ganz im Gegenteil, sich ‚zu verschließen‘, eine ‚ablehnende Haltung‘ einzunehmen, eine Mitwirkung ‚zu verweigern‘.
Überall dort, wo es gilt, gemeinsame Entscheidungen zu fällen, ist neben allen Arten von Argumenten für oder gegen eine Sache immer auch die Motivation der einzelnen im Spiel. Direkt oder indirekt unterstützen sie den Prozess positiv oder blockieren ihn negativ. Rationale Argumente alleine reichen oft nicht aus, die motivationalen Faktoren zu beeinflussen.
Die Faktoren, die eine Motivation beeinflussen können, sind äußerst vielfältig, in der heutigen Forschung nur partiell geklärt, und können von Person zu Person, von Situation zu Situation fast beliebig variieren. Persönliche Vorlieben, persönliche Erlebnisse, Sympathie und Antipathie, Einbindung in Milieus mit bestimmten fixierten Rollen oder speziellen Werten, und vieles mehr. Ein unbeliebtes Beispiel: wenn ein Politiker bestimmten Lobbyisten nahe steht, deren konkrete wirtschaftliche Interessen durch Bürgerinteressen betroffen sind, wird es für die Bürger schwer, sich politisch Gehör zu verschaffen.
OHNE KOMMUNIKATION GEHT NICHTS
Sollte jemand über genügend Wissen verfügen (was praktisch nie der Fall ist, weil man als Spezialist viele andere Spezialisten benötigt) und sollte jemand zugleich auch noch motiviert sein, sein Wissen wirksam einzusetzen (keinesfalls selbstverständlich, nicht für alle denkbaren Situationen), wird es zusätzlich notwendig sein, mit all jenen Menschen in Verbindung zu treten, die für eine Lösung des Problems wichtig sind. Das geht nicht ab ohne Kommunikation. Überwiegend wird diese Kommunikation eine sprachliche Kommunikation sein, oft zusätzlich unterstützt durch Bilder, Videos, Pläne, Modelle, und vieles mehr.
Kommunikation ist nicht einfach. Nicht nur, dass man überhaupt in der Lage sein sollte vor und mit anderen sinnvoll sprechen zu können, man muss auch alle wichtige Punkte durch die Kommunikation dem anderen verständlich machen. Jeder, der spezielle Ausbildungen durchlaufen hat (was letztlich schon in der Schule beginnt), weiß, dass es oft viele Monate, Jahre, oder gar Jahrzehnte an Lernen und Praxis braucht, um gewisse Wissensgebiete zu verstehen und sie zur Anwendung bringen zu können. Fachgespräche sind hier nur mit solchen Menschen möglich, die eine ähnliche Ausbildung durchlaufen haben und ähnliche Expertise anhäufen konnten. Was aber, wenn solch eine Experte von Gebiet A auf einen Nicht-Experten trifft (z.B. einen Stadtverordneten) oder auf einen Experten auf Gebiet B? Eine solche Kommunikation kommt nicht wirklich zustande, oder verläuft pro forma, oder aber, ist man ernsthaft an wirklichem Verstehen interessiert, man nimmt sich füreinander hinreichend viel Zeit.
In einer Welt wie der unseren, ist aber Zeit ein äußerst knappes Gut geworden. Ich selbst habe es über Jahre erlebt, dass wir zwar einen interdisziplinären, viele Fachbereiche und Disziplinen übergreifenden Studiengang gründen durften, aber die geltenden Kapazitätspläne, die festlegen, wie viel Zeit ein Lehrender für eine bestimmte Zahl von Studierenden aufwenden darf, sehen nicht vor, dass Lehrende aus verschiedenen Disziplinen natürlich einen erheblich höheren Zeitbedarf für die Vorbereitung, Abstimmung und Nachbereitung benötigen, da sie sich ja auch mit den verschiedenen Wissenshorizonten ihrer Kollegen-innen auseinander setzen müssen. Bei einem Lehrdeputat, das sowieso schon grenzwertig ist, führen daher freiwillige zusätzliche Kommunikationszeiten zu einer erheblichen Mehr- und letztlich grenzwertigen Belastung. Dabei ist diese individuelle Belastung ja gar nicht das zentrale Problem, sondern die Möglichkeit, einen pädagogisch und wissenschaftlich vertretbaren Konsens herzustellen (eine ähnliche Situation findet sich heute in vielen Schulen, wo durch Inklusion und erhöhten Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund die Anforderungen an das Lehrpersonal sehr gestiegen ist, ohne dass dafür von Kultusministerien zusätzlich hinreichende Unterstützungen bereitgestellt wurden).
Während also der Aufwand an Kommunikation erheblich steigt, wenn die Zahl der Beteiligten und die Anzahl der unterschiedlichen Wissenskulturen zunimmt, wird die Zeit für Prozesse konträr eher immer knapper, was die Prozessqualität unausweichlich verschlechtert.
SIMULIERTES DENKEN
Angesichts der wachsenden Komplexität von Sachverhalten und der Zunahme an unterschiedlichen Erfahrungswerten, die die einzelnen Personen in einem Problemlösungsprozess einbringen, hat sich im Bereich des Engineering schon seit Jahrzehnten durchgesetzt, dass man das versammelte Wissen zum Problem in Form von ‚Simulationen‚ für alle in gewisser Weise sichtbar macht. In besonderen Kontexten benutzt man sogar ‚interaktive Simulationen‚, die es erlauben, dass der einzelne direkte eigene Erfahrungen sammeln kann, wie das System, die Umgebung, die anderen Beteiligten, auf die eigenen Handlungen reagieren (plakative Beispiele: Flugsimulator, Autosimulator, Schiffssimulator). Die Komplexität heutiger Anwendungen und Situationen erlauben es nicht mehr, dass man alle Eventualitäten rein gedanklich ‚vorweg nimmt‘.
Lange Zeit waren solche Simulationen vornehmlich bei den Ingenieuren zu Hause. Militärische Manöver, Unternehmensspiele oder vielfältige Rollenspielszenarien verdeutlichen aber, dass Simulationen nicht auf rein technische Anwendungen beschränkt sein müssen. Und wenn heute (laut Statistik) im Jahr 2018 ca. 40 Mio Bundesbürger regelmäßig Computerspiele spielen (auch jenseits der 50!), online, auch in Teams mit anderen, dann zeigt dies, das das Format ‚interaktive Simulation‘ ein sehr allgemeines, leistungsfähiges Lern- und Kommunikationsformat ist.
Umso erstaunlicher ist es, dass dieses Format seinen Weg noch nicht in den Bereich von allgemeinen Kommunikations- und Problemlösungsverfahren (Planungsverfahren) gefunden hat.
NUR DREI SIND EINS
So grob die bisherige Systematik erscheint, die Faktoren Wissen (Erfahrung), Motivation und Kommunikation sind alle drei bis zu einem gewissen minimalen Grad notwendig, damit ein einzelner zu einem konstruktiven Prozess beitragen kann. Mangelndes Wissen kann prinzipiell mit Hilfe von Motivation und Kommunikation ‚aktiviert‘ werden; mangelnde Kommunikation kann auch mit Hilfe von Motivation und Wissen ‚aktiviert‘ werden; Mangelnde Motivation jedoch ist sehr schwer ‚aktivierbar‘. Dabei erscheint der Faktor Motivation der wichtigste und zugleich heikelste Faktor von allen dreien zu sein. Das ‚Aktivieren‘ eines Faktors, das heißt der nachträgliche ‚Erwerb‘ von Wissen oder Kommunikationsfähigkeit – oder auch Motivation — ist prinzipiell möglich, erfordert aber echte Anstrengungen und real Zeit, ohne Erfolgsgarantie.
FORTSETZUNG
Eine Fortsetzung zu diesem Beitrag findet sich HIER.
Einen Überblick über alle Blogeinträge von Autor cagent nach Titeln findet sich HIER.
Einen Überblick über alle Themenbereiche des Blogs findet sich HIER.