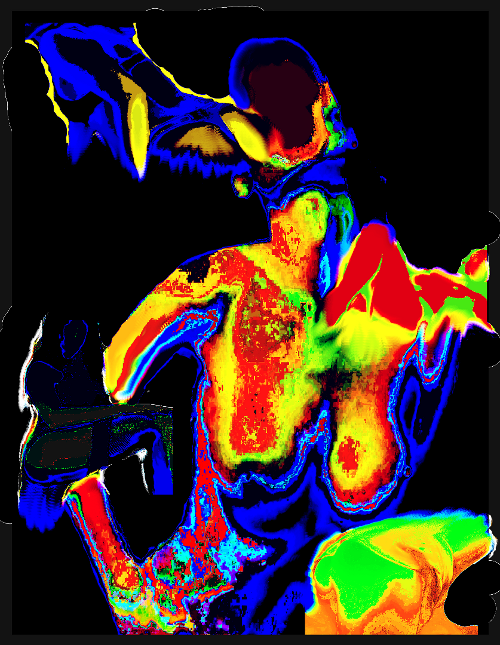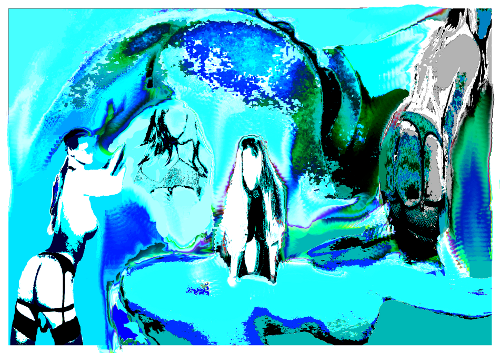PDF
Worum es geht
Im Zeitalter von Fake News (manche sprechen schon vom postfaktischen Zeitalter ) scheint der Begriff der Wahrheit abhanden gekommen zu sein. Dies trifft aber nicht zu. Die folgenden Zeilen kann man als Fortsetzung des vorausgehenden Beitrags lesen.
I. ARBEITSDEFINITION VON WAHRHEIT
1) In dem vorausgehenden Beitrag wurde angenommen, dass Wahrheit zunächst einmal die Gesamtheit des Wissens, der Erfahrungen und der Emotionen ist, die einer einzelnen Person zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung steht. Was immer geschrieben, gedacht, gesagt usw. wird, jeder einzelne versteht und handelt auf
der Basis dessen, was er zu diesem Zeitpunkt in sich angesammelt hat.
2) Eine zentrale Einsicht ist dabei, dass unser Gehirn die aktuellen sensorischen Daten – externe wie interne– sofort, und automatisch, mit dem abgleicht, was bisher zu diesem Zeitpunkt im Gedächtnis verfügbar ist. Dadurch erleben wir alles, was uns begegnet, im Lichte des bislang Bekannten. Unsere Wahrnehmung ist eine unausweichlich interpretierte Wahrnehmung.
3) Ein Beispiel: Wenn jemand gefragt wird, ’ist dies dein Kugelschreiber?’, und dieser jemand antwortet mit ’Ja’, dann nimmt er einen Gegenstand wahr (als Ereignis seines Bewusstseins) und dieser jemand stellt zugleich fest, dass sein Gedächtnis in ihm eine Konzept aktiviert hat, bezogen auf das er diesen Gegenstand als seinen Kugelschreiber interpretieren kann. Für diesen jemand ist Wahrheit dann die Übereinstimmung zwischen (i) einer Wahrnehmung als einem Ereignis ’Kugelschreiber’ in seinem Bewusstsein, (ii) einem zugleich aktivierten Konstrukt aus dem Gedächtnis ’mein Kugelschreiber’, sowie (iii) der Fähigkeit, erkennen zu können, dass das Wahrnehmungsereignis ’Kugelschreiber’ eine mögliche Instanz des Erinnerungsereignisses ’mein Kugelschreiber’ ist. Das Erinnerungsereignis ’mein Kugelschreiber’ repräsentiert (iv) zudem den Bedeutungsanteil des sprachlichen Ausdrucks ’dein Kugelschreiber’. Letzteres setzt voraus, dass der Frager und der Antwortende (v) beide die gleiche Sprache gelernt haben und der Ausdruck ’dein Kugelschreiber’ aus Sicht des Fragenden und ’mein Kugelschreiber’ aus Sicht des Antwortenden von beiden (vi) in gleicher Weise interpretiert wird.
4) Anzumerken ist hier, dass jene Ereignisse, die ihm Bewusstsein als Wahrnehmungen aufschlagen können, unterschiedlich leicht zwischen zwei Teilnehmern des Gesprächs identifiziert werden können. Einmal können Aussagen über die empirische Welt sehr viele komplizierte Zusammenhänge implizieren, die nicht sofort erkennbar sind (wie funktioniert ein Fernseher, ein Computer, ein Smartphone…), zum anderen kann es
sein, dass die beiden Gesprächsteilnehmer die benutzte Sprache sehr unterschiedlich gelernt haben können (Fachausdrücke, spezielle Redewendungen, Art der Bedeutungszuschreibung, usw). Obwohl der Sachverhalt vielleicht im Prinzip erklärbar wäre, kann es sein, dass beide Gesprächsteilnehmer im Moment des Gesprächs
damit überfordert sind.
5) Ferner kann man sich durch dieses Beispiel nochmals deutlich machen, dass die Bezeichnung der Gesamtheit des Wissens, der Erfahrung und der Emotionen eines Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt als der subjektiven Wahrheit dieses Menschen ihren Sinn darin besitzt, dass dieser Mensch in dem Moment, wo er gefragt wird, ob es sich SO verhält, nur dann ’Ja’ sagen wird, wenn der gefragte Mensch in seiner subjektiven Wahrheit Elemente findet, die diesem So-sein entsprechen. Das ’So-sein’ aus der Frage muss ein Bestandteil der subjektiven Wahrheit sein und nur dann kann ein Mensch auf eine Anfrage hin sagen, ja, das wahrgenommene So-sein findet in der subjektiven Wahrheit eine Entsprechung. Die Fähigkeit zur Wahrheit erscheint somit primär in der subjektiven Wahrheit eines Menschen begründet zu sein.
II. WAHRHEIT UND LEBENSFORM
1) Ergänzend zu diesem geschilderten grundsätzlichem Zusammenhang wissen wir, dass die subjektive Wahrheit nicht unabhängig ist von dem Lebensprozess des jeweiligen Menschen. Alles, was ein Mensch erlebt, was auf ihn einwirkt, kann in diesem Menschen als Ereignis erlebbar werden, kann ihn beeinflussen, kann ihn
verändern. Dazu gehört natürlich auch das eigene Tun. Wenn jemand durch den Wald läuft und merkt, dass er laufen kann, wie sich das Laufen anfühlt, wie sich dies langfristig auf seinen Körperzustand auswirkt, dann beeinflusst dies auch das individuelle Erkennen von Welt und von sich selbst, als jemand, der laufen und
Fühlen kann. Wenn stattdessen Kinder in Kobaldminen arbeiten müssen statt zu lernen, sich vielfältig neu entdecken zu können, dann wird diesen Kinder mit der Vorenthaltung einer Lebenspraxis zugleich ihr Inneres zerstört; es kann nur ein verzerrter Aufbau von Persönlichkeit stattfinden. Wir schwärmen derweil von den angeblich umweltfreundlichen Elektroautos, die wir fahren sollen. Oder: wenn Kinder im Dauerhagel von Granaten und Bomben aufwachsen müssen, um sich herum Verwundete und Tote erleben müssen, dann werden sie sich selbst entfremdet, weil verschiedene Machthaber ihre Macht in Stellvertreterkriegen meinen, ausagieren zu müssen.
2) Aufgrund der so unendlich verschiedenen Lebensprozesse auf dieser Erde können sich in den Menschen, die von ihrer Natur aus weitgehend strukturgleich sind, ganz unterschiedliche subjektive Wahrheiten ansammeln. Derselbe Mensch sieht dann die Welt anders, handelt anders, fühlt anders. Es ist dann nahezu unausweichlich, dass sich bei der Begegnung von zwei Menschen zwei verschiedene Wahrheiten begegnen. Je nachdem, wie ähnlich oder unähnlich die Lebensprozesse dieser Menschen sind, sind auch die subjektiven Wahrheiten eher ähnlich oder unähnlich.
3) Wie man beobachten kann, tendieren Menschen dazu, sich vorzugsweise mit solchen Menschen zu treffen, mit ihnen zu reden, mit ihnen zusammen etwas tun, die mit ihnen bezüglich ihrer subjektiven Wahrheiten möglichst ähnlich sind. Manche meinen, solche selbstbezügliche Gruppen (’Echokammer’, ’Filterblase’) auch
im Internet, in den sozialen Netzwerken entdecken zu können. Obwohl das Internet im Prinzip die ganze Welt zugänglich macht [Anmerkung: Allerdings nicht in Ländern, in denen der Zugang zum Internet kontrolliert wird, wie z.B. massiv in China.], treffen sich Menschen vorzugsweise mit denen, die sie kennen, und mit denen sie eine ähnliche Meinung teilen. Man muss aber dazu gar nicht ins Internet schauen. Auch im Alltag kann man beobachten, dass jeder einzelne Mitglied unterschiedlicher sozialer Gruppen ist, in denen er sich wohl fühlt, weil man dort zu bestimmten Themen eine gleiche Anschauung vorfindet. An meiner Hochschule, an der Studierende aus mehr als 100 Ländern vertreten sind, kann man beobachten, dass die Studierenden
vorzugsweise unter sich bleiben statt die Vielfalt zu nutzen. Und die vielfältigen Beziehungskonflikte, die sich zwischen Nachbarn, Freunden, Lebenspartnern, Mitarbeitern usw. finden, sind ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie real unterschiedlich subjektive Wahrheiten im Alltag sind. [Anmerkung: Allerdings ist diese Aufsplitterung in viele kleine Gruppen von ‚Gleichgesinnten‘ nicht notwendigerweise nur negativ; die Kultivierung von Vielfalt braucht eine natürliche Umgebung, in der Vielfalt möglich ist und geschätzt wird.]
4) Obwohl also der Mechanismus der subjektiven Wahrheitsbildung grob betrachtet einfach erscheint, hat man den Eindruck, dass wir Menschen uns dieses Sachverhaltes im Alltag nicht wirklich bewusst sind. Wie schnell fühlt sich jemand beleidigt, verletzt, oder gar angegriffen, nur weil jemand sich anders verhält, als man es im Lichte seiner subjektiven Wahrheit erwartet. Wie schnell neigen wir dazu, uns von anderen abzugrenzen, sie abzustempeln als krank, verrückt, oder böse zu erklären, nur weil sie anders sind als wir selbst.
III. GEDANKE UND REALE WELT
1) Bis hierher konnte man den Eindruck gewinnen, als ob die subjektive Wahrheit ein rein gedankliches, theoretisches Etwas ist, das sich allerdings im Handeln bemerkbar machen kann. Doch schon durch die Erwähnung des Lebensprozesses, innerhalb dessen sich die subjektive Wahrheit bildet, konnte man ahnen, dass die konkreten Umstände ein wichtiges Moment an der subjektiven Wahrheit spielen. Dies bedeutet z.B., dass wir die Welt nicht nur in einer bestimmten Weise sehen, sondern wir verhalten uns ganz konkret in dieser Welt aufgrund unserer subjektiven Wahrheit (= Weltsicht), wir leben unseren Alltag mit ganz konkreten Objekten, Besitztümern und Gewohnheiten. Eine andere subjektive Wahrheit (bzw. Weltsicht) ist daher in der
Regel nicht nur ein bloßer abstrakter Gedanke, sondern kann zugleich reale, konkrete Veränderungen des eigenen Alltags implizieren. Da aber schrecken wir alle (verständlicherweise?) sofort zurück, blitzartig, vielleicht sogar unbewusst. Über die Wahrheit reden mag grundsätzlich chic sein, aber wenn die zur Sprache kommenden
Wahrheit anders ist als die eigene Wahrheit, dann zucken wir zurück. Dann wird es unheimlich, ungemütlich; dann können allerlei Ängste aufsteigen: was ist das für eine Welt, die anders wäre als die Welt, die wir kennen? Der verinnerlichten Welt korrespondiert immer auch eine reale Alltagswelt. [Anmerkung: In diesen Kontext passt vielleicht das paradoxe Beispiel, das Jesus von Nazareth in den Mund gelegt wird mit dem Bild, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen würde, als dass ein Reicher in den Himmel gelangen könnte. Eine Deutung wäre, dass jemand der als Reicher
(unterstellt: auf Kosten anderer) in einer Wirklichkeitsblase lebt, die angenehm ist, und er als Reicher wenig Motive hat, dies zu ändern. Allerdings, was man gerne
übersieht, ein solches Verhaftetsein mit der aktuellen Situation, die als angenehm gilt, gilt in vielen Abstufungen für jeden Menschen. In den Apartheitsgefängnissen von Südafrika (heute als Museum zu besichtigen) gab es z.B. unter den Gefangenen eine klare Hierarchie: die Bosse, die Helfer der Bosse, und der Rest. Kein Boss wäre auf die Idee gekommen, seine relativen Vorteile zu Gunsten von allen aufzugeben.]
2) In der Struktur der gesellschaftliche Wirklichkeit kann man den Mechanismus der parzellierten Wahrheiten wiederfinden. Eine Gesellschaft ist mit unzähligen Rollen durchsetzt, mit Ämtern, Amtsbezeichnungen, Institutionen usw.. Dazu kommen in vielen Ländern Abgrenzungen von unterschiedlichen ethnischen Gruppen. Weiter gibt es Nationalstaaten, die ihre eigenen Wahrheiten pflegen. Die Tendenz, das Andere, die Anderen negativ zu belegen, um seinen eigenen Status dadurch indirekt zu sichern, findet sich zwischenstaatlich auch wieder. [Anmerkung: Gut zu erkennen in dem Erstarken von nationalistisch-populistischen Doktrinen in leider immer mehr Ländern der Erde.] Eine unkritische Ausübung gewachsener partieller Wahrheiten kann Unterschiede dann nur zementieren oder gar vergrößern, anstatt sie zu überbrücken und zu allgemeineren Wahrheitsbegriffen zu kommen.
IV. EINE KULTUR DER WAHRHEIT?
1) Wenn man sieht wie unglaublich stark die Tendenz unter uns Menschen ist, aktuelle, partielle Wahrheiten (die aus Sicht des einzelnen nicht partiell, sondern universell sind) mit einer bestimmten Alltagspraxis zu verknüpfen und diese fest zu schreiben, dann könnte man auf die Idee kommen, zu fragen, was wir als Menschen tun können, um dieser starken Tendenz ein natürliches Gegengewicht gegenüber zu stellen, das
dem Trieb zu partiellen Wahrheit entgegenwirken könnte.
2) Innerhalb der Rechtsgeschichte kann man beobachten, wie im Laufe von Jahrtausenden das Recht des Angeklagten häppchenweise soweit gestärkt wurde, dass es in modernen Staaten mit einem funktionieren Rechtssystem üblich geworden ist, jemanden erst dann tatsächlich zu verurteilen, nachdem in nachvollziehbaren, transparenten Verfahren die Schuld bzw. Unschuld objektiv festgestellt worden ist. Dennoch kann man sehen, dass gerade in der Gegenwart in vielen Staaten wieder eine umgekehrte Entwicklung um sich greift: der methodische Respekt vor der Gefahr partieller Wahrheiten wird einfachüber Bord geworfen und Menschen werden allein aufgrund ihrer Andersheit und eines blinden Verdachts vorverurteilt, gefoltert, und
aus ihren gesellschaftlichen Stellungen verjagt.
3) Innerhalb der Welt der Ideen gab es eine ähnliche Entwicklung wie im Rechtssystem: mit dem Aufkommen der empirischen experimentellen Wissenschaften in Kooperation mit Mathematischen Strukturen konnte das Reden über Sachverhalte, über mögliche Entstehungsprozesse und über mögliche Entwicklungen auf ganz neue Weise transparent gemacht werden, nachvollziehbar, überprüfbar, wiederholbar, unabhängig von dem Fühlen und Meinen eines einzelnen [Anmerkung: Allerdings nicht ganz!]. Diese Art von Wissenschaft kann großartige Erfolge aufweisen, ohne die das heutige
Leben gar nicht vorstellbar wäre. Doch auch hier können wir heute beobachten, wie selbst in den Ländern mit einem entwickelten Wissenschaftssystem die wissenschaftlichen Prinzipien zunehmen kurzfristigen politischen
und ökonomischen Interessen geopfert werden, die jeweils auf den partiellen Wahrheiten der Akteure beruhen.
4) Es drängt sich dann die Frage auf, ob der Zustand der vielen (partiellen) Wahrheiten generell vermeidbar wäre bzw. wie man ihn konstruktiv nutzen könnte, um auf der Basis der partiellen Wahrheiten zu einer umfassenderen weniger partiellen Wahrheit zu kommen.
5) Eine beliebte Lösungsstrategie ist ein autoritär-diktatorisches Gesellschaftssystem, das überhaupt nur noch eine partielle Wahrheit zulässt. Dies kennen wir aus der Geschichte und leider auch aus der Gegenwart: Gleichschaltung von Presse, Medien; Zensur; nur noch eine Meinung zählt.
6) Die Alternative ist die berühmte offene Gesellschaft, in der eine Vielfalt von partiellen Wahrheiten möglich ist, verbunden mit dem Vertrauen, dass die Vielfalt zu entsprechend vielen neuen erweiterten partiellen Wahrheiten führen kann (nicht muss!). Hier gibt es – im Idealfall – eine Fülle unterschiedlicher Medien und keine Zensur. Entsprechend wären auch alle Lern- und Erziehungsprozesse nicht an einem Drill, einer
autoritären Abrichtung der Kinder und Jugendlichen orientiert, sondern an offenen, kreativen Lernprozessen, mit viel Austausch, mit vielen Experimenten.
7) Allerdings kann man beobachten kann, dass viele Menschen nicht von vornherein solche offenen, kreativen Lernprozesse gut finden oder unterstützen, weil sie viel anstrengender sind als einfach einer autoritären Vorgabe zu folgen. Und es ist ein historisches Faktum, dass partielle Wahrheitsmodelle bei geeigneter Propaganda und gesellschaftlichen Druck eine große Anhängerschaft finden können. Dies war und ist eine große Versuchung für alle narzisstischen und machtorientierte Menschen. Das scheinbar Einfachere und Bequemere wird damit sprichwörtlich zum ’highway to hell’.
8) Für eine offene Gesellschaft als natürlicher Entwicklungsumgebung für das Entstehen immer allgemeinerer Wahrheiten sowohl in den Beteiligten wie auch im Alltag scheinen von daher geeignete Bildungsprozesse sowie freie, unzensierte Medien (dazu gehört heute auch das Internet) eine grundlegende Voraussetzung zu
sein. Die Verfügbarkeit solcher Prozesse und Medien kann zwar keine bessere gedachte und gelebte Wahrheit garantieren, sie sind allerdings notwendige Voraussetzungen, für eine umfassendere Kultur der Wahrheit. [Anmerkung: Natürlich braucht es noch mehr Elemente, um einen einigermaßen freien Raum für möglicheübergreifende Wahrheiten zu ermöglichen.]
9) Vor diesem Hintergrund ist die weltweit zu beobachtende Erosion von freien Medien und einer offenen, kreativen Bildung ein deutliches Alarmsignal, das wir Menschen offensichtlich dabei sind, den Weg in ein wahrheitsfähige Zukunft immer mehr zu blockieren. Letztlich blockieren wir uns als Menschen damit nur selbst. Allerdings,
aus der kritischen Beobachtung alleine folgen keine wirkenden konkreten Verbesserungen. Ohne eine bessere Vision von Wahrheit ist auch kein alternatives Handeln möglich. Deswegen versuchen ja autoritäre Regierungen immer, zu zensieren und mit Propaganda und Fake-News die Öffentlichkeit zu verwirren.
V. KONTEXTE
Einen Überblick über alle Blogeinträge von Autor cagent nach Titeln findet sich HIER.
Einen Überblick über alle Themenbereiche des Blogs findet sich HIER.
Das aktuelle Publikationsinteresse des Blogs findet sich HIER.
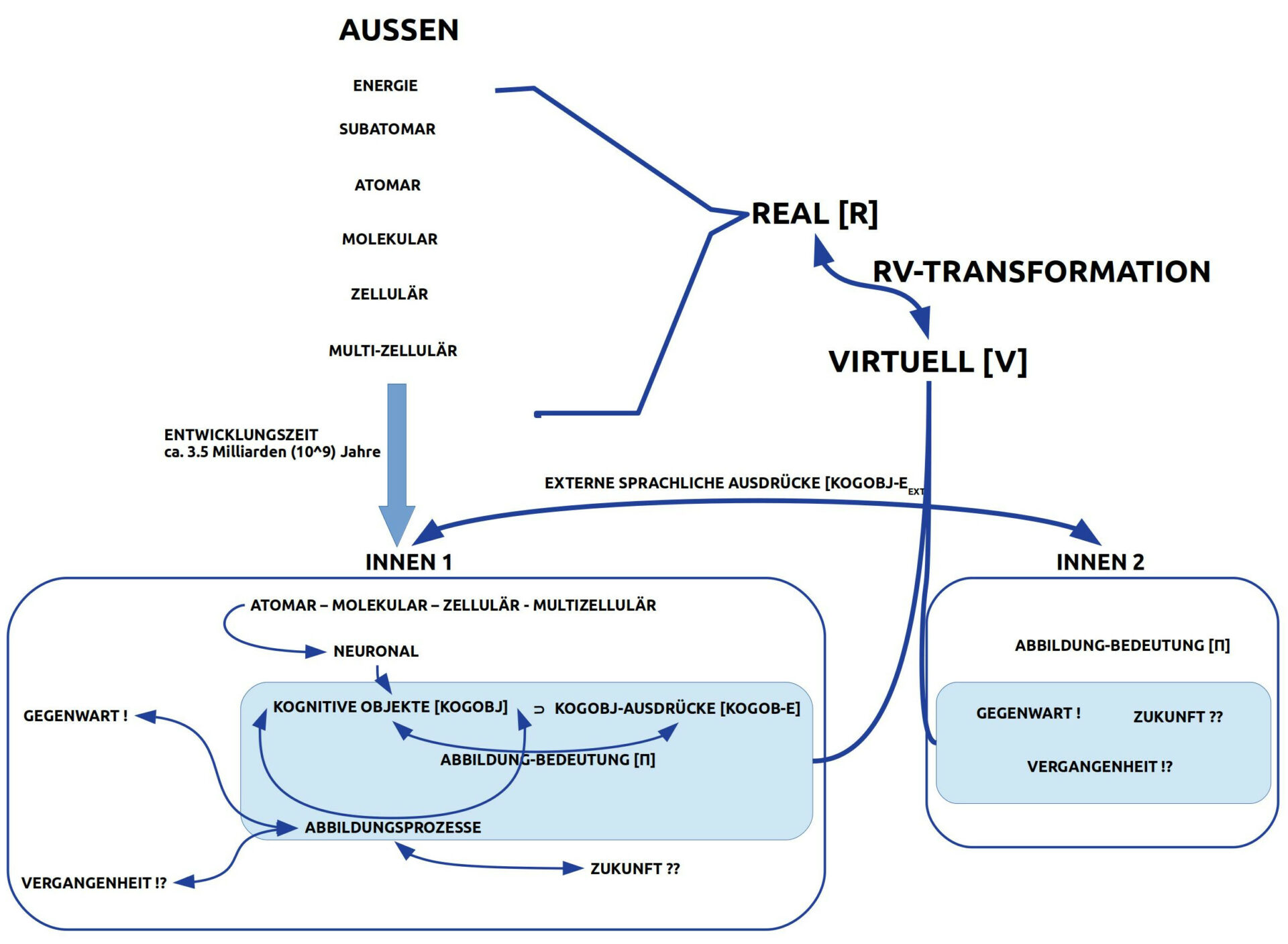
 Bild 1
Bild 1 Bild 2
Bild 2