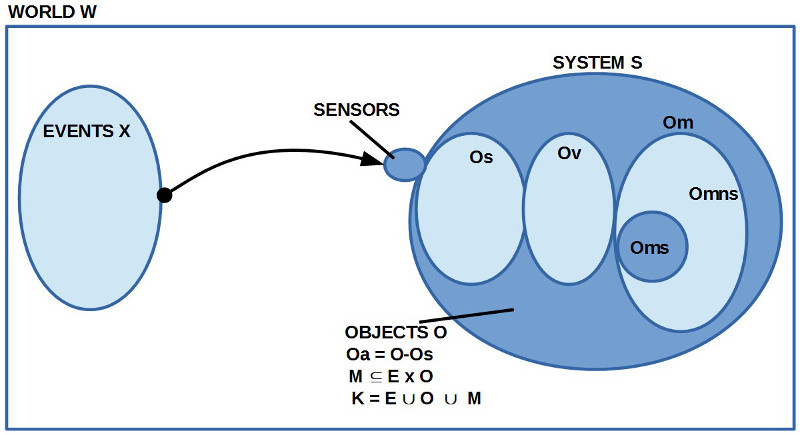Journal: Philosophie Jetzt – Menschenbild
ISSN 2365-5062, 10.Dez. 2017
URL: cognitiveagent.org
Email: info@cognitiveagent.org
Autor: cagent
Email: cagent@cognitiveagent.org
IDEE
Wenn man gedanklich in komplexen Strukturen unterwegs ist, kann es bisweilen helfen, sich zwischen drin bewusst zu machen, wo man gerade steht,
worum es eigentlich geht. Dies ist so ein Moment.
I. BILDERFLUT AUS MÖGLICHKEIT
Wir leben in einer Zeit, wo die Technik die
Möglichkeit eröffnet hat, Bilder zu erschaffen, die
mehr oder weniger alles zum Gegenstand haben, auch
Unsinniges, Idiotisches, reinste Fantasien, explizite
Lügen, Verleumdungen, … und für einen normalen homo
sapiens, der – bei intaktem Sehvermögen – primär ein
visuell orientiertes Lebewesen ist, führt diese Bilderflut
dazu, dass die wahre Realität sich immer mehr auflöst
in dieser Bildersuppe. Selbst wenn die Bilder noch als
Science Fiction, Fantasy, Crime, … gelabelt werden, im
Gehirn entsteht eine Bildersuppe, wo sich wahres Reales
mit Irrealem zu einem Gebräu mischt, das den Besitzer
dieses Gehirns in einen Dauerzustand der zunehmenden
Desorientierung versetzt. Der einzelne Bildproduzent
mag vielleicht sogar redliche Absichten haben, aber die
Masse der irrealen Bilder folgt ihren eigenen Gesetzen.
Das einzelne Gehirn verliert Orientierungsmarken.
Die Bereitschaft und Neigung von Menschen aller
Bildungsschichten selbst mit Doktortiteln (!), beliebig
wirre populistische, fundamentalistische oder esoterische
Anschauungen über die Welt als ’wahr’ zu übernehmen,
ist manifest und erschreckend. Wenn die grundlegenden
Wahrheitsfähigkeit von Menschen versagt, weil das
Gehirn über zu wenig verlässlich Ankerpunkte in der
Realität verfügt, dann ist alles möglich. Ein alter Lehrsatz
aus der Logik besagt: Aus Falschem folgt alles.
II. RÜCKERINNERUNG AN DIE WAHRHEIT
In einem vorausgehenden – eher grundlegenden –
Blogeintrag sind jene elementaren Grundstrukturen angesprochen worden, durch die jeder homo sapiens eine elementare Wahrheitsfähigkeit besitzt, auch in
Kommunikation und Kooperation mit anderen.
Aus diesem Text geht hervor, dass es grundsätzlich
möglich ist, dass dies aber kein Selbstgänger ist,
keinen Automatismus darstellt. Das Gelingen von
Wahrheit erfordert höchste Konzentration, erfordert
kontinuierliche Anstrengung, und vor allem auch das
Zusammenspiel vieler Faktoren. Moderne Demokratien
mit einer funktionierenden Öffentlichkeit, mit einem
ausgebauten Bildungs- und Forschungssystem kommen
diesen wissenschaftsphilosophischen Anforderungen
bislang am nächsten.
Wer die Bedeutung dieser Mechanismen zur
Voraussetzung von Wahrheit kennt und sich die
reale Welt anschaut, der kann weltweit eine
starke Rückentwicklung dieser Strukturen und
Prozesse beobachten, eine weltweite Regression
von Wahrheitsprozessen. Die Folgen sind schon jetzt
katastrophal und werden sich eher verstärken. Den Preis
werden letztlich alle zahlen. Wer glaubt, man könne sich
in einem Teilprozess isolieren, der täuscht sich.
Allerdings, im Fall der Wahrheit gelten andere Regel
als rein physikalische: Wahrheit selbst ist ein nicht-
physikalisch beschreibbares Phänomen. Es entstand
gegen alle Physik, es entstand auf eine Weise, die wir
bislang noch nicht richtig verstehen, und es macht im
Ansatz alle zu Verlierern, die sich außerhalb stellen.
Genauso irrational, wie sich weltweit eine Regression
von Wahrheit ereignen kann – und aktuell ereignet –,
genauso bizarr ist zugleich, warum so viele Mächtige
solch eine ungeheure Angst vor Wahrheit haben
(schon immer). Warum eigentlich? Warum gibt es
diesen ungeheuren Drang dazu, andere Menschen
zu kontrollieren, Ihnen Meinungen und Verhalten
vorzuschreiben, Algorithmen zu entwickeln, die die
Menschen in Richtungen leiten sollen, die schon falsch
sind, als sie ausgedacht wurden?
Solange es nur einen einzigen Menschen auf dem
Planet Erde gibt, so lange gibt es die Chance für
Wahrheit. Und so lange es die Chance für Wahrheit gibt,
muss jeder, der Wahrheit verrät, unterdrückt, verleugnet
sich als Verräter sehen, als Feind des Lebens.
More Beyond Noise – How Far away? Which kind of Distance?
III. UNIVERSUM – ERDE – LEBEN
Wenn man zu ahnen beginnt, wie kostbar Wahrheit
ist, wie schwierig sie zu gewinnen ist, und wenn man
weiß, wie viele Milliarden Jahre das Leben auf der
Erde gebraucht hat, um wahrheitsfähig zu werden, auch
noch in den späten Phase der Lebensform homo bzw.
dann des homo sapiens, dann kann man umgekehrt
zu einer geradezu andächtigen Haltung finden, wenn
man sich anschaut, was die modernen experimentellen
Wissenschaften im Laufe der letzten Jahrhundert, sogar
erst in den letzten Jahrzehnten (!!!) alles offenlegen
konnten.
Man bedenke, was wir primär wahrnehmen, das
ist Gegenwart, und die unfassbaren Blicke zurück in
die Vergangenheit der Evolution des Lebens und des
Universums (und möglicher weiterer Universen) liegen
nicht auf der Straße! Die Gegenwart ist Gegenwart und
ihr, der Gegenwart, Hinweise auf eine Zeit davor zu
entlocken, das war – und ist – eine der größten geistigen
Leistungen des homo sapiens.
Die Vergangenheit kann sich ja niemals direkt zeigen,
sondern immer nur dann, wenn eine bestimmte Zeit
mit ihren Strukturen und Prozessen Artefakte erzeugt
hat, die im Fluss der Zeit dann später als Spuren,
Hinweise, vorkommen, die ein Lebewesen dieser neuen
Gegenwart dann auch als Hinweise auf eine andere Zeit
erkennt.
So hat die Geologie irgendwann bemerkt, dass die
verschiedenen Gesteinsschichten möglicherweise
Ablagerungen aus vorausgehenden Zeiten sind.
Entsprechend haben die Biologen aus Versteinerungen
auf biologische Lebensformen schließen können,
die ’früher einmal’ gelebt hatten, heute aber nicht
mehr oder, heute auch, aber eventuell verändert. Die
Physik entdeckte, dass aufgrund der unterschiedlichen
Leuchtkraft gleicher Sternphänomene große Entfernungen im Universum anzunehmen sind, und mit der Fixierung der Geschwindigkeit des Lichts konnte
man auch auf Zeiten schließen, aus denen dieses Licht
gekommen sein muss: man war plötzlich bei vielen
Milliarden Jahren vor der Gegenwart.
Diese wenigen und vereinfachten Beispiele können
andeuten, dass und wie in der Gegenwart Zeichen einer
Vergangenheit aufleuchten können, die unsere inneren
Augen des Verstehens in die Lage versetzen, die scheinbare Absolutheit der Gegenwart zu überwinden und langsam zu begreifen, dass die Gegenwart nur
ein Moment in einer langen, sehr langen Kette von
Momenten ist, und dass es Muster zu geben scheint,
Regeln, Gesetze, Dynamiken, die man beschreiben
kann, die ansatzweise verstehbar machen, warum dies
alles heute ist, wie es ist.
Es versteht sich von selbst, dass diese unfassbaren
Erkenntnisleistungen der letzten Jahrzehnte nicht nur
möglich wurden, weil der Mensch qua Mensch über
eine grundlegende Wahrheitsfähigkeit verfügt, sondern
weil der Mensch im Laufe der letzten Jahrtausende
vielerlei Techniken, Abläufe ausgebildet hat, die ihm
bei diesen Erkenntnisprozessen unterstützen. Man
findet sie im technischen Bereich (Messgeräte, Computer,
Datenbanken, Produktionsprozesse, Materialtechniken, …..), im institutionellen Training
(langwierige Bildungsprozesse mit immer feineren
Spezialisierungen), in staatlichen Förderbereichen, aber
auch – und vielleicht vor allem! – in einer Verbesserung
der Denktechniken, und hier am wichtigsten die
Ausbildung leistungsfähiger formaler Sprachen in vielen
Bereichen, zentral die Entwicklung der modernen
Mathematik. Ohne die moderne Mathematik und formale
Logik wäre fast nichts von all dem möglich geworden,
was moderne Wissenschaft ausmacht.
Wenn man um die zentrale Rolle der modernen
Mathematik weiß und dann sieht, welche geringe Wertschätzung Mathematik sowohl im
Ausbildungssystem wie in der gesamten Kultur einer
Gesellschaft (auch in Deutschland) genießt, dann kann
man auch hier sehr wohl von einem Teilaspekt der
allgemeinen Regression von Wahrheit sprechen.(Anmerkung: Es wäre mal eine interessante empirische Untersuchung, wie viel
Prozent einer Bevölkerung überhaupt weiß, was Mathematik ist. Leider
muss man feststellen, dass das, was in den Schulen als Mathematik
verkauft wird, oft nicht viel mit Mathematik zu tun hat, sondern mit
irgendwelchen Rechenvorschriften, wie man Zeichen manipuliert, die
man Zahlen nennt. Immerhin, mehr als Nichts.)
Im Zusammenspiel von grundlegender Wahrheitsfähigkeit, eingebettet in komplexe institutionelle Lernprozesse, angereichert mit wissensdienlichen
Technologien, haben die modernen experimentellen
Wissenschaften es also geschafft, durch immer
komplexere Beschreibungen der Phänomene und ihrer
Dynamiken in Form von Modellen bzw. Theorien, den
Gang der Vergangenheit bis zum Heute ansatzweise
plausibel zu machen, sondern auf der Basis dieser
Modelle/ Theorien wurde es auch möglich, ansatzweise
wissenschaftlich begründete Vermutungen über die
Zukunft anzustellen.
In einfachen Fällen, bei wenigen beteiligten Faktoren
mit wenigen internen Freiheitsgraden und für einen
begrenzten Zeithorizont kann man solche Vermutungen ü̈ber die Zukunft (kühn auch Prognosen genannt), einigermaßen überprüfen. Je größer die Zahl der
beteiligten Faktoren, je mehr innere Freiheitsgrade, je
weitreichender der Zeitrahmen, um so schwieriger wir
solch eine Prognose. So erscheint die Berechnung des
Zeitpunktes, ab wann die Aufblähung unserer Sonne
aufgrund von Fusionsprozessen ein biologisches Leben
auf der Erde unmöglich machen wird, relativ sicher
voraussagbar, das Verhalten eines einfachen Tieres in
einer Umgebung über mehr als 24 Stunden dagegen ist
schon fast unmöglich.
Dies kann uns daran erinnern, dass wir es in der
Gegenwart mit sehr unterschiedlichen Systemen zu
tun haben. Das Universum (oder vielleicht sogar die
Universen) mag komplex sein, aber es erweist sich
bislang als grundsätzlich verstehbar, ebenfalls z.B. die
geologischen Prozesse auf unserem Heimatplaneten
Erde; das, was die Biologen Leben nennen, also
biologisches Leben, entzieht sich aber den bekannten
physikalischen Kategorien. Wir haben es hier mit
Dynamiken zu tun, die irgendwie anders sind, ohne dass
es bislang gelingt, diese spezifische Andersheit adäquat
zu erklären.
IV. KOGNITIVER BLINDER FLECK
Eine Besonderheit des Gegenstandsbereiches
biologisches Leben ist, dass diejenigen, die es
untersuchen, selbst Teil des Gegenstandes sind.
Die biologischen Forscher, die Biologen – wie überhaupt
alle Forscher dieser Welt – sind selbst ja auch Teil
des Biologischen. Als Exemplare der Lebensform
homo sapiens sind sie ganz klar einer Lebensform
zugeordnet, die ihre eigene typische Geschichte hat,
die sich als homo sapiens ca. 200.000 Jahre entwickelt
hat mit einer Inkubationszeit von ca. 100.000 Jahren, in
denen sich verschiedene ältere Menschenformen verteilt
über ganz Afrika partiell miteinander vermischt haben.
Nach neuesten Erkenntnissen hat dann jener Teil, der
dann vor ca. 60.000/ 70.000 Jahren aus Ostafrika
ausgewandert ist, einige tausend Jahre mit den damals
schon aussterbenden Neandertalern im Gebiet des
heutigen Israel friedlich zusammen gelebt, was durch
Vermischungen dann einige Prozent Neandertaler-Gene
im Genom des homo sapiens hinterließ, und zwar bei
allen Menschen auf der heutigen Welt, die gemessen
wurden.
Die Tatsache, dass die erforschenden Biologen selbst
Teil dessen sind, was sie erforschen, muss nicht per
se ein Problem sein. Es kann aber zu einem Problem
werden, wenn die Biologen Methoden zur Untersuchung
des Phänomens biologisches Leben anwenden, die
für Gegenstandsbereiche entwickelt wurden, die keine
biologischen Gegenstände sind.
In der modernen Biologie wurden bislang sehr
viele grundlegende Methoden angewendet, die
unterschiedlichste Teilbereiche zu erklären scheinen: In
Kooperation mit der Geologie konnte man verschiedenen
Phasen der Erde identifizieren, Bodenbeschaffenheiten,
Klima, Magnetfeld, und vieles mehr. In Kooperation
mit Physik, Chemie und Genetik konnten die
Feinstrukturen von Zellen erfasst werden, ihre
Dynamiken, ihre Wechselwirkungen mit den jeweiligen
Umgebungen, Vererbungsprozesse, Generierung neuer
genetischer Strukturen und vieles mehr. Der immer
komplexere Körperbau konnte von seinen physikalisch-
mechanischen wie auch chemischen Besonderheiten her
immer mehr entschlüsselt werden. Die Physiologie half,
die sich entwickelnden Nervensysteme zu analysieren,
sie in ihrer Wechselwirkung mit dem Organismus
ansatzweise zu verstehen. und vieles mehr.
Die sehr entwickelten Lebensformen, speziell dann
der homo sapiens, zeigen aber dann Dynamiken, die
sich den bisher bekannten und genutzten Methoden
entziehen. Die grundlegende Wahrheitsfähigkeit des
homo sapiens, eingebunden in grundlegende Fähigkeit
zur symbolischen Sprache, zu komplexen Kooperation,
zu komplexen Weltbildern, dies konstituiert Phänomene
einer neuen Qualität. Der biologische Gegenstand homo
sapiens ist ein Gegenstand, der sich selbst erklären
kann, und in dem Maße, wie er sich selbst erklärt,
fängt er an, sich auf eine neue, bis dahin biologisch
unbekannte Weise, zu verändern.
Traditioneller Weise gab es in den letzten
Jahrtausenden spezielle Erklärungsmodelle zum
Phänomen der Geistigkeit des homo sapiens, die
man – vereinfachend – unter dem Begriff klassisch-
philosophische Erklärung zusammen fassen kann.
Dieses Erklärungsmodell beginnt im Subjektiven und
hat immer versucht, die gesamte Wirklichkeit aus der
Perspektive des Subjektiven zu erklären.
Die Werke der großen Philosophen – beginnend
mit den Griechen – sind denkerische Großtaten,
die bis heute beeindrucken können. Sie leiden
allerdings alle an der Tatsache, dass man aus der
Perspektive des Subjektiven heraus von vornherein
auf wichtige grundlegende Erkenntnisse verzichtet
hatte (in einer Art methodischen Selbstbeschränkung,
analog der methodischen Selbstbeschränkung der
modernen experimentellen Wissenschaften). Das,
was diese subjekt-basierte und subjekt-orientierte
Philosophie im Laufe der Jahrtausende bislang erkannt
hat, wird dadurch nicht falsch, aber es leidet daran,
dass es nur einen Ausschnitt beschreibt ohne seine
Fundierungsprozesse.
Eigentlich ist das Subjektive (oder das ’Geistige’,
wie die philosophische Tradition gerne sagt) das
schwierigste Phänomen für die moderne Wissenschaft, das provozierendste, aber durch die frühzeitige Selbstbeschränkung der Biologie auf die bisherigen
Methoden und zugleich durch die Selbstbeschränkung
der klassischen Philosophie auf das Subjektive wird
das Phänomen des Lebens seiner Radikalität beraubt.
Es wird sozusagen schon in einer Vor-Verabredung der
Wissenschaften entmündigt.
In einem Folgeartikel sollte dieser blinde Fleck der
Wissenschaften in Verabredung mit der Philosophie
nochmals direkt adressiert werden, etwa: Das Subjektive
im Universum: Maximaler Störfall oder Sichtbarwerdung
von etwas radikal Neuem?
KONTEXT BLOG
Einen Überblick über alle Blogeinträge von Autor cagent nach Titeln findet sich HIER.
Einen Überblick über alle Themenbereiche des Blogs findet sich HIER.
Das aktuelle Publikationsinteresse des Blogs findet sich HIER